Schüchternheit
Hast du Angst, im Mittelpunkt zu stehen? Schüchternheit kann uns hemmen und innerlich einengen. In diesem Lebenshilfe-ABC-Beitrag erfährst du Wissenswertes zum Umgang mit Schüchternheit.



Ob wir schüchtern sind oder nicht, lässt sich unter anderem anhand folgender Fragen beantworten:
- Hast du Angst, im Mittelpunkt zu stehen?
- Lähmt dich der Gedanke, was andere von dir denken könnten?
- Hast du Schwierigkeiten, deine Meinung zu äußern oder auf dein Recht zu pochen?
- Bist du konfliktscheu?
- Wirst du bei Komplimenten leicht rot?
- Bekommst du vielleicht bereits bei einer harmlosen Bitte um eine Gefälligkeit ein unangenehmes Gefühl oder sogar einen Schweißausbruch?
- Fühlst du dich bei Veranstaltungen und in Gegenwart fremder Menschen unsicher?
- Bleibst du lieber bei dem, was du kennst?
Wenn du einige oder sogar alle dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, bist du vermutlich schüchtern. Schüchternheit ist eine Eigenschaft, die wir meist übergreifend zeigen. Schüchterne Menschen haben tendenziell ein geringeres Selbstwertgefühl und -vertrauen und denken eher negativ von sich.
Wie äußert sich Schüchternheit?
Schüchternheit zeigt sich in vier Bereichen:
Bereich 1: In den Gedanken
Betroffene quälen sich mit der Sorge, dass andere schlecht über sie denken könnten. Sie fordern von sich Fehlerlosigkeit und Perfektion. Sie beschäftigen sich stark mit sich selbst und ihrer Außenwirkung, anstatt ihre Aufmerksamkeit dem momentanen Geschehen zu widmen. Sie haben eine schlechte Meinung von sich und glauben, sich mit ihrem Verhalten und ihrer Person lächerlich zu machen. Deshalb haben sie Angst, abgelehnt zu werden. Sie neigen zum Grübeln.
Ein Beispiel: Du hältst zum ersten Mal einen längeren Workshop vor einer größeren Menschenmenge. Der Gedanke daran beschäftigt dich schon im Vorfeld. Du bereitest dich sehr gut vor, um ja nichts falsch zu machen. Während des Workshops fragst du dich, ob es den Teilnehmenden wohl gefällt und was sie über dich denken. Nach dem Workshop grübelst du noch länger darüber nach.
Bereich 2: In den Gefühlen
Betroffene verspüren Unsicherheit, Hemmungen und Angst.
Ein Beispiel: Du fühlst dich bereits im Vorfeld des Workshops ängstlich. In der Situation selbst bist du unsicher und gestresst.
Bereich 3: In körperlichen Reaktionen
Da schüchterne Menschen unbekannte zwischenmenschliche Situationen eher als eine Bedrohung ansehen, reagiert ihr Körper mit typischen Stressreaktionen:
- Beschleunigter Puls
- Herzrasen
- Leere im Kopf
- Feuchte Hände
- Beschleunigung der Atmung
- Muskelanspannung
- Erweiterung der Gefäße (insbesondere im Gesicht, was dann zum Erröten führt)
- Zittern und Frieren
- Kloß im Hals
- Harndrang
- Beklemmungsgefühle
- Übelkeit
- Schwindel
Ein Beispiel: Während des Workshops hast du eine beschleunigte Herzfrequenz, feucht-kalte Hände, dein Kopf wird rot und der Magen zieht sich zusammen.
Bereich 4: Im Verhalten
Betroffene meiden je nach Grad der Schüchternheit Situationen, in denen sie befürchten, sich lächerlich machen zu können, oder sie treten sie mit ausgeprägtem Lampenfieber an. Sie verzichten auf Forderungen, halten mit ihrer Meinung eher hinter dem Berg, erzählen wenig oder nichts von sich, sind allerdings eher gute Zuhörende und stellen Fragen, verbergen tendenziell ihre Gefühle, nehmen weniger oder sogar keinen Kontakt auf oder ziehen sich generell eher zurück. Sie versuchen auch manchmal, ihre Unsicherheit hinter einer coolen Fassade zu verstecken und wirken dadurch arrogant und überheblich.
Ein Beispiel: Du verhältst dich während des Workshops schüchtern und zurückhaltend, sprichst mit leiser Stimme und überlässt eher dem Publikum das Feld.
Ursachen: Woher kommt die Schüchternheit?
Schüchternheit übernehmen wir von den Eltern oder erlernen sie. Es wird von einer vererbten Komponente ausgegangen.
Der Erziehungsstil der Eltern und die Erfahrung mit Gleichaltrigen spielen eine große Rolle. So haben betroffene Kinder das ängstliche Verhalten bei ihren Eltern beobachtet, sie wurden überbehütet oder besonders streng erzogen. In gewissen Altersstufen ist Schüchternheit völlig normal. Schüchternheit kann sich auch später noch entwickeln, z.B. wenn wir im Jugend- oder sogar Erwachsenenalter die Erfahrung machen, ausgegrenzt zu werden, und uns das veranlasst, an uns zu zweifeln. Mit zunehmendem Alter kann die Schüchternheit nachlassen.
Entsprechende Lernerfahrungen speichern Betroffene in Form von negativen Einstellungen und Bildern ab. Sie haben Katastrophenerwartungen: "Die oder der andere wird mich ablehnen, das kann ich nicht ertragen." Auch haben viele schüchterne Menschen ein negatives Selbstbild: "Ich bin nicht in Ordnung; mit mir stimmt etwas nicht." Beides erzeugt Angst.
Was zählt nicht zur Schüchternheit?
Unterscheidung 1: Soziale Phobie
Ein weiterer Begriff, der in diesem Zusammenhang oft fällt, ist die Soziale Angst oder Soziale Phobie. Der Unterschied zwischen Schüchternheit und Sozialer Phobie ist eher quantitativ.
Menschen, die unter einer Sozialen Phobie leiden, sind noch stärker in ihrem Leben eingeschränkt als schüchterne Menschen. Sie haben stärkere Ängste im zwischenmenschlichen Bereich, vor allem in spezifischen Situationen, sowie Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen (z.B. in der Öffentlichkeit zu sprechen, zu essen, zu trinken, vor anderen zu schreiben, sich evtl. sogar mit Menschen zu treffen, einkaufen zu gehen etc.). Auch leiden sie noch mehr unter den durch Schüchternheit entstehenden körperlichen Beschwerden.
Unterscheidung 2: Introversion
Schüchterne Menschen leiden bis zu einem gewissen Grad darunter, dass sie sozial eingeschränkt sind, können aber etwas dagegen tun. Introversion ist eine Veranlagung, die mit Schüchternheit einhergehen kann, aber nicht muss. Introvertierte Menschen können die Gegenwart anderer genießen, ebenso wie – in dosierter Form – im Mittelpunkt zu stehen oder sich etwas Neuem zu öffnen. Sie haben aber ein stärkeres Bedürfnis nach Einkehr, Alleinsein, Ruhe und Rückzug als extrovertierte Menschen. Sie erleben diese Neigung in der Regel nicht als Belastung, sondern sind damit im Einklang.
Unterscheidung 3: Ängstlich-vermeidende Persönlichkeit
Bei einer ängstlich-vermeidenden Persönlichkeit sind die Betroffenen sozial noch stärker eingeschränkt als bei der Sozialen Phobie. Das Erleben von Scham, Unsicherheit und Kontakthemmung aufgrund der Angst vor Kritik sind universell und an die Persönlichkeit geknüpft.
Folgen von Schüchternheit
Es gibt unterschiedliche Folgen von Schüchternheit:
- Als Folge der körperlichen Reaktionen beginnen Betroffene, soziale Situationen zu meiden und geraten in einen Kreislauf.
- Ein negatives Selbstbild und negative Erfahrungen führen zu Angst vor der Angst und Vermeidung.
- Die Vermeidung stärkt das negative Selbstbild und verhindert, dass soziale Fähigkeiten erlernt und trainiert werden.
- Schüchternheit kann auch in eine Soziale Phobie übergehen.
- Bei stärkerer Ausprägung können Einsamkeit, Isolation oder eine Depression die Folge sein.
- Schüchternheit kann als Bewältigungsform Substanzkonsum begünstigen.
- Partnerschaften und Freundschaften sind unter Umständen nicht im Gleichgewicht.
- Im Beruf können sich schüchterne Personen ggf. nicht voll entfalten, da sie sich zu wenig zutrauen.
Wie können wir Schüchternheit überwinden?
Schüchternheit ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können etwas daran ändern. Wenn Ängste und Einschränkungen uns deutlich in unserer Lebensführung und -qualität beeinträchtigen, z. B. wenn wir wenig Anschluss oder nur schwer eine Partnerin oder einen Partner finden, unser Handlungsradius deutlich eingeschränkt ist und wir uns auch beruflich eingeschränkt fühlen, ist es sinnvoll, dass wir an der Schüchternheit arbeiten.
Aus einem schüchternen Menschen wird allerdings nur selten ein arenenfüllender Alleinunterhalter. Doch können Schüchterne ihre sozialen Fähigkeiten erweitern und verbessern. Sie können ihr Selbstvertrauen stärken und lernen, sich ungezwungener in der Gegenwart anderer zu fühlen, ihre Meinung zu äußern und ihre Rechte einzufordern.
Schüchternheit muss nicht besiegt werden, wenn die Schüchternheit zum Beispiel nicht so stark ausgeprägt ist, wir sie als Teil von uns integriert haben, ohne uns allzu eingeschränkt zu fühlen, oder wir nicht wirklich unter ihr leiden.
6 Schritte, die dir aus der Schüchternheit heraushelfen
Schritt 1: Überprüfe deine Bewertungen
Denke deine Katastrophenerwartung bis zum Ende weiter:
- Was könnte schlimmstenfalls passieren?
- Bin ich wirklich in Lebensgefahr?
- Was könnte ich verlieren, wenn ich nicht in die Situation gehe, was könnte ich gewinnen?
- Ist die Situation kurzfristig oder langfristig?
Nehme deine Gedanken und Glaubenssätze ins Visier und wandle sie ins Positive um. Wir können lernen, unsere Schüchternheit als eine Stärke zu sehen und sie für uns zu nutzen.
Schritt 2: Stärke dein Selbstwertgefühl
In dem Maße, in dem du dich akzeptieren lernst, bist du auch weniger schüchtern. Du kannst lernen, die Überzeugung zu entwickeln, dass du ein liebenswerter Mensch bist und auch anderen etwas zu bieten hast. Dafür kannst du dir täglich selbstbejahende Sätze sagen wie: „Ich habe viele Stärken.“ Auch kannst du nahestehende Menschen fragen, was sie an dir mögen.
Schritt 3: Nutze deine Vorstellungskraft
Male dir möglichst lebendig aus, wie du ruhig auf andere zugehst und ein Gespräch beginnst. Je eher du dich in der Rolle eines gelassenen und selbstbewussten Menschen siehst, desto einfacher gelingt es dir, selbstbewusst aufzutreten. Dafür kannst du bewusst Affirmationen wählen, die dir dabei helfen, dich täglich auf "Erfolgskurs" zu programmieren, z. B.: "Ich bin selbstbewusst und gehe auf andere zu." Auch eine regelmäßig ausgeübte Meditation mit Visualisierung, z. B. wie wir eine Situation meistern, kann unterstützend wirken. Dafür benötigen wir aber etwas Übung.
Schritt 4: Achte auf eine offene und entspannte Körpersprache
Nimm Blickkontakt auf, halte ihn und lächle immer wieder einmal freundlich. So signalisierst du anderen, dass du Kontakt aufnehmen möchtest. Du selbst fühlst dich mit einer veränderten Körpersprache sicherer und wohler. Dafür kannst du auch mal bewusst in deinen Körper hineinspüren und dich mit ihm verbinden:
- Welche Haltung nehme ich gerade ein?
- Wo fühle ich mich vielleicht angespannt?
- Halte ich mich aufrecht?
- Wie geht es mir physisch?
- Bin ich über meine Füße geerdet?
- Nehme ich Blickkontakt auf?
- Welche Gesten zeige ich und welche zeige ich nicht?
Schritt 5: Werde aktiv und beginne mit kleinen Schritten
Stelle dir kleine Aufgaben, die du dann auch ausführst. Nur durch Übung kannst du lernen, selbstbewusster aufzutreten und dich freier zu fühlen. Es hilft also, wenn wir nach und nach aus unserer Komfortzone gehen (z. B. mal alleine eine Veranstaltung besuchen oder auf eine Person zugehen, jemanden anlächeln, in sozialen Medien sichtbar werden etc.). Professionelle Begleitung kann dabei hilfreich sein.
Schritt 6: Erlaube dir, unsicher und schüchtern zu sein
Je mehr du dich schämst, schüchtern und gehemmt zu sein, desto schüchterner und verkrampfter bist du. Deshalb: Lerne deine Schüchternheit anzunehmen. Schüchtern zu sein ist keine Schande und nichts, wofür du dich verurteilen müsstest. Statt zu bewerten, können wir uns also darin üben, einfach zu beobachten, wie es uns geht, und sagen: "Es ist in Ordnung!"
Bin ich konfliktfähig oder scheue ich Konflikte und gehe diesen "des lieben Friedens willen" aus dem Weg? Dieser Psychotest gibt dir gibt dir erste Hinweise zu deiner Konfliktfähigkeit.
Wie zufrieden bist du mit dir? Wärst du gerne ein anderer Mensch oder bist du rundum glücklich so, wie du bist? In diesem Zufriedenheitstest erhältst du erste Antworten.
Dieser Psychotest gibt dir erste Hinweise, ob du unter der Angst leidest, von anderen abgelehnt zu werden.
Lust auf mehr positive Impulse und Inspirationen in Beiträgen, Podcasts, Videos? Dann bestelle unseren kostenlosen redaktionellen PAL-Newsletter.
PAL steht für praktisch anwendbare Lebenshilfe aus der Hand erfahrener Psychotherapeuten und Coaches. Der Verlag ist spezialisiert auf psychologische Ratgebertexte für psychische Probleme und Krisensituationen, aber auch auf aufbauende Denkanstöße und Inspirationen für ein erfülltes Leben. Alle Ratschläge und Tipps werden auf der Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie, der Gesprächstherapie sowie des systemischen Coachings entwickelt. Mehr zu unserer Arbeit und Methodik hier
PAL Verlagsgesellschaft GmbH
Rilkestr. 10, 80686 München
Tel. für Bestellungen: +49 89/ 901 800 68
Tel. Verlag: +49 89/379 139 48
(Montag–Freitag, 9–13 Uhr)
E-Mail: info@palverlag.de
psychotipps.com
partnerschaft-beziehung.de
lebensfreude-app.de

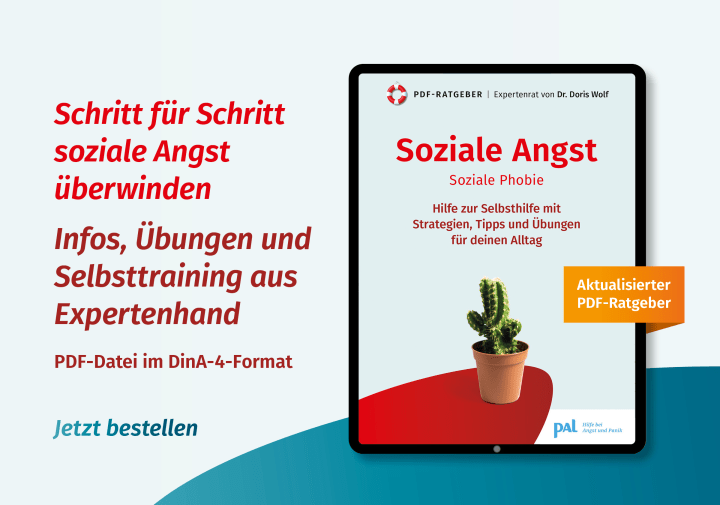








Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, dann berichte davon und hilf so auch anderen auf dem Weg in ein zufriedenes Leben. Bitte beachte dabei unsere PAL- Nettiquette, die sich an der allgemeinen Internet-Nettiquette orientiert: Alle Inhalte, auch Kommentare und Beiträge von Leserinnen und Lesern, sollten in respektvollem und wertschätzendem Ton verfasst sein und dem Zweck dienen, andere weiterzubringen. Wir lehnen es ab, dass Menschen vorsätzlich verbal verletzt sowie Falschaussagen oder versteckte Werbungen verbreitet werden. Deshalb werden wir dahingehende Beiträge streichen.